Wille des Leistungsberechtigten als Ausgangspunkt
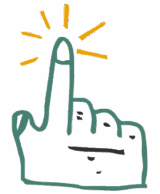
Hinwendung zum individuelle Willen bzw. den eigenen Zielen der Leistungsberechtigten
- Was will der Mensch?
- Was treibt ihn an?
- Wofür lohnt es sich aus seiner Sicht, Herausforderungen zu bewältigen?
Dies bedeutet eine grundlegende Abkehr von der Sichtweise, dass die Fachkraft besser weiß, was gut und sinnvoll ist. Es verlangt Unvoreingenommenheit und Neugier, „mit den Menschen zu reden statt über sie“.
Je stärker die Leistung auf den Willen des Klienten bezogen ist, desto größer ist die Chance auf Umsetzung und nachhaltige Lösungen!
Unterstützung von Eigeninitiative und Selbstwirksamkeit
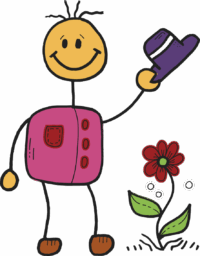
In der sozialräumlichen Arbeit steht der Grundsatz „Aktivierende Tätigkeit vor betreuender Tätigkeit“ im Mittelpunkt. Es geht darum, die Verantwortung bei den Menschen zu belassen und nur dort zu unterstützen, wo es wirklich notwendig ist. Das Erreichen von Zielen aus eigener Kraft fördert die Selbstwirksamkeit und stärkt das Selbstvertrauen der Leistungsberechtigten deutlich mehr als aktive Hilfe von außen.
Fokus auf Ressourcen
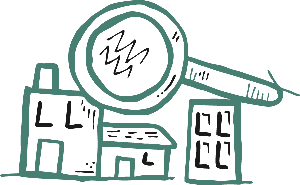
Unter dem Gesichtspunkt der Sozialraumorientierung liegt der Fokus auf den Ressourcen und Stärken eines Menschen sowie seines sozialen Umfelds.
Dabei werden die vorhandenen Möglichkeiten und Angebote im eigenen Lebensraum betrachtet. Es geht darum, die positiven Eigenschaften, Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Menschen sowie die stärkenden Faktoren in seinem Umfeld zu erkennen und zu nutzen.
Ziel ist es, die Selbstwirksamkeit zu fördern und die individuelle Entwicklung durch die Unterstützung vorhandener Ressourcen zu ermöglichen.
Teilhabe
„Teilhabe“ meint das Einbezogensein in Lebenssituationen.
Der Begriff stammt aus der 2008 in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention, deren Ziele es sind
- Menschen mit Behinderungen „den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten zu gewährleisten“ und
- „die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern“.

Diese Forderung führte zu einem Perspektivwechsel von der bisher eher betreuenden Eingliederungshilfe hin zu einer unterstützenden Begleitung in ein möglichst hohes Maß an Selbstbestimmung.
Das Ziel der Sozialraumorientierung ist die uneingeschränkte Teilhabe aller Menschen.
Zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise
Der Fokus wird weggelenkt von der Randgruppe, um die es in diesem Moment geht, die oft auch vereinfacht „etikettiert“ und damit unangemessen homogen betrachtet wird, weg zu:
- der Sichtweise, dass es sich hierbei um sehr unterschiedliche Menschen mit jeweils unterschiedlichen Bedürfnissen handelt
- der Erweiterung des Blickfeldes weit über die ursprüngliche Gruppe hinaus, um gemeinsame Bedarfe etc. zu erkennen, usw. usf. (das noch etwas ausbauen).
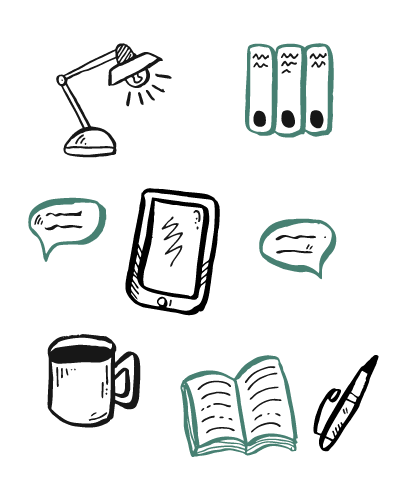
Kooperation und Vernetzung
Für eine ganzheitliche und nachhaltige Lösung sozialer Problemstellungen ist es zwingend notwendig, über Zuständigkeiten und das Feld der unmittelbaren Aufgabe hinauszudenken sowie gemeinsam an einem Strang zu ziehen.
Dies bedeutet, dass wir Träger uns gegenseitig auch in sich überschneidenden Tätigkeitsbereichen nicht als Konkurrenten, sondern als Kollegen verstehen. Es bedeutet, dass es sich wirtschaftlich lohnt, sich abzustimmen, um langfristig günstigere Lösungen zu erzielen. Es bedeutet, eine gemeinsame Vision zu haben und diese gemeinsam umzusetzen.
